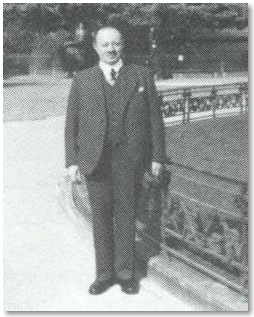(...) Die Zielaufschrift auf dem Zug lautete „Weimar“, sodass wir wussten, wir fahren in das berüchtigte Konzentrationslager Buchenwald nahe der Stadt, die Goethe berühmt gemacht hatte, bevor die alte deutsche Kultur durch die „Kultur“ des Tausendjährigen Reiches ersetzt wurde.
Der Zug fuhr um 9 Uhr am Abend weg – mit seiner Ladung von bestürzten und verängstigten Leuten. Ungefähr vier Stunden später kamen wir in Weimar an. Eine Schar von SS-Leuten aus dem Lager, bewaffnet mit Pistolen, Peitschen, Stahlruten und ähnlicher Ausrüstung erwartete uns. Sie brüllten uns an, wir sollten uns aus dem Zug machen – Beeilt Euch! – Bewegt Euch! – Schnell! – Stellt Euch in eine Reihe! – Gesicht gegen die Wand! – Keine Bewegung! – Stillgestanden! Jemand bewegte sich, woraufhin ein Gewehrkolben gegen seinen Kopf knallte. Geschrei und Gekreisch bis wir alle in Reihe vor der Mauer standen, mit dem Gesicht nach dort, ohne die geringste Bewegung. Für die jüngeren unter uns, die schnell reagierten, viele sportlich trainiert und daran gewöhnt, militärähnliche Befehle auszuführen, war es leicht, die Befehlen zu befolgen, aber die älteren Männer, die sich nur langsam bewegten und durch die Aufregung benommen waren oder unter Schock standen, waren schlecht dran. Viele wurden geschlagen, einige schwer. Es war ganz wie in einem Irrenhaus.
Ein neuer Aufruf – wieder wurden wir gezählt, unsere Namen wurden mit den Einträgen auf den Originallisten abgeglichen und wir wurden auf Lastwagen gehetzt, nachdem uns ein Bewacher die Verordnung über aufrührerisches Verhalten vorgelesen hatte. Er sagte uns, dass wir jetzt in einem Konzentrationslager seien (zu diesem Zeitpunkt nur theoretisch, weil wir ja noch am Bahnhof waren) und dass der Versuch zum Widerstand, zur Flucht oder das Nichtbefolgen von Befehlen und jegliche Verletzung der Lagerordnung mit dem Tode bestraft würden. Jedes fünfte Wort war „erschiessen“, damit vergewisserte er sich, dass wir ihn verstanden. Auf dem Weg zu den Lastwagen mussten wir durch ein Spalier von Bewachern, die uns anbrüllten und auf uns einschlugen, damit wir schneller liefen. Wiederum war es so, dass die jüngeren Leute schnell vorankamen und den Schlägen ausweichen konnten, während es für die älteren schwierig war, zu den Lastwagen zu rennen und sie schnell zu besteigen.
Schließlich fuhren wir vom Bahnhof weg und hinauf auf den Berg, auf dem sich das Lager befand. Die Lastwagen hielten in einiger Entfernung vom Haupttor. Es war weit nach Mitternacht. Das ganze Gebiet war hell erleuchtet durch die Scheinwerfer von den vielen Wachtürmen. Wir wurden wieder angebrüllt: „Herunter von den Wagen, lauft, Ihr ...“, und wir mussten in einem Spießrutenlauf durch das Spalier der auf uns einpeitschenden Wachmannschaft durch das Haupttor auf einen großen Platz rennen, der schon mit Tausenden von Neuankömmlingen gefüllt war. Ich sah eine große Uhr über dem Haupteingang, die kurz nach zwei Uhr am frühen Morgen des 12. November 1938 anzeigte, beide Daten sind fest in meine Erinnerung eingebrannt.
Wir mussten uns wieder in Reih und Glied aufstellen und wurden wieder gezählt, danach begann die Registrierung. Nur die Suchscheinwerfer, die über dem Heer der Gefangenen kreisten, durchbrachen die Finsternis. Es gab abermals viel Geschrei und Gebrüll, einige Männer fielen bewusstlos um, einige bluteten, einige mussten sich übergeben, SS-Männer sprangen herum, knüppelten auf den einen Gefangenen ein, schlugen einen anderen – es war wie in der Hölle. Auf dem Boden lagen überall Bewusstlose oder Tote herum, man konnte sie kaum unterscheiden.
Es war eine trockene Nacht. Der Boden war ziemlich fest. Später erlebten wir, dass der Regen den Erdboden in lehmigen Schlamm verwandelte. Wenn es regnete – und in dieser Jahreszeit regnete es oft – versanken wir knöcheltief im Schlamm, der uns die Schuhe von den Füßen zog.
Das Chaos um zwei Uhr an jenem Morgen war unbeschreiblich. Wachposten jagten uns von einer Stelle zur anderen, Gefangene versuchten, Freunde oder Verwandte zu finden, von denen sie getrennt worden waren, Männer suchten eine Orientierung zu finden oder den Befehlen nachzukommen, mit denen man sie angeschnauzt hatte. Einige hatten Taschen bei sich, andere waren auf offener Straße verhaftet worden, nur mit dem ausgestattet, was sie auf dem Körper trugen. Viele benötigten ihre Medizin, über die sie jetzt nicht verfügten. Einige versuchten „über den Dienstweg“ von den Bewachern das eine oder andere herauszufinden, mussten aber erleben, dass es nur die eine Antwort auf alle Fragen oder Bitten gab: „Halt die Fresse, dreckiger Jude!“ Zur Bekräftigung gab es einen Schlag mit der Peitsche oder dem Gewehrkolben.
Dieser Zustand dauerte etwa sieben Stunden. Es gab keine Toiletten. Seiner Notdurft musste man dort, wo man sich gerade befand, nachkommen, ohne die sanitären Errungenschaften der zivilisierten Welt. Wir waren nicht mehr in der zivilisierten Welt, wir waren in Buchenwald, in der Hölle.
Der Tag brach spät an – ein bewölkter Himmel hellte langsam auf, als wir zu riesigen Holzbaracken laufen mussten, Notunterkünften mit Holzpritschen an den Seiten und in der Mitte, mit zwei schmalen Gängen und bereits voll belegt mit früher Angekommenen. Wir versuchten, einen kleinen Fleck zum Hinlegen auf den Pritschen zu finden. Auf diesen gab es keine Kopffreiheit zum Aufrechtsitzen. Zu dem Zeitpunkt, als ich die Baracke Nr. 5A erreichte, eine von den fünf Unterkünften, die man für die Unterbringung der Neuangekommenen errichtet hatte, war diese voll gepackt mit etwa zweitausend Personen, alle dicht an dicht, und für mich war kein Platz vorhanden, um mich dazwischen zu quetschen. Ich schaffte es aber dann, nach oben auf eine Pritsche zu klettern, auf der die Leute schon dicht gedrängt wie in einer Sardinendose lagen. Es gab dort einen Spalt breit Platz zwischen den Füßen der dort Liegenden und dem Pritschenende, etwa einen halben Meter, wo ich mich, auf der Seite liegend, ausbreiten konnte. Zu meinem Glück (!) starb einige Tage später ein dort Liegender und ich konnte seinen leer gewordenen Platz übernehmen. So kam ich von dem Fußende weg, von wo ich leicht im Schlaf hätte herunter stürzen können, etwa drei Meter tief.
Ich war in dem Gedränge der fast zehntausend jüdischen Männer, die im Verlauf der „Novemberaktion“ nach Buchenwald geschafft wurden, von meinem Vater getrennt worden. Während der beiden Wochen, die er in dem Lager war, sah ich ihn nur ein einziges Mal. Er sah schrecklich aus. Ich hörte von einem seiner Kollegen, dass man ihn schwer geschlagen und er dann einen Nervenzusammenbruch erlitten hatte.
(...) Es fing an zu regnen und der Boden verwandelte sich in klebrigen Matsch, knöcheltief und tiefer. Am Sonntag, den 13. November, gab es die erste warme Mahlzeit, die erste Mahlzeit überhaupt. Es war ein schmackhafter Fleicheintopf, den wir mit Heißhunger verschlangen. Später erfuhren wir, dass es Walfleisch war. Es dauerte nicht lange, bis fast alle Gefangenen unter Durchfall litten, der besonders schlimm war, weil jegliche sanitären Einrichtungen und sanitäre Versorgung fehlten. Der gesamte Lagerbereich, in dem wir eingesperrt waren, verwandelte sich in eine Kloake. Es gab kein Toilettenpapier, es gab kein Wasser zum Waschen, es gab überhaupt kein Wasser. Und jetzt fast zehntausend Männer mit Durchfall. Leute starben an Dehydration (= Wasserentzug) aufgrund des fehlenden Trinkwassers. Es gab absolut kein Wasser! Wir konnten unsere verschmutzte Kleidung nicht wechseln. In dieser Kleidung steckten wir drei Monate lang, bei Tag und bei Nacht. Das gilt für diejenigen, etwas mehr als zweihundert, die noch im Februar 1939 in Buchenwald waren und dann in das Hauptlager kamen und dort, nach einer warmen Dusche, mit normaler Häftlingskleidung ausgestattet wurden, mit Streifen und dem Davidstern und Nummern auf Jacke und Hose zur Kennzeichnung.