
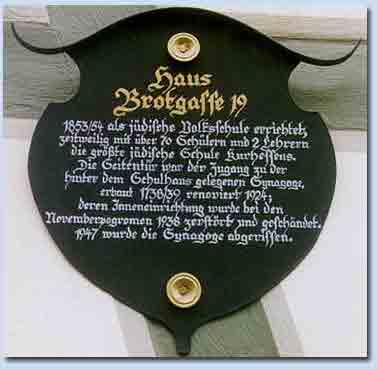
Die jüdische
Gemeinde ließ 1853/54 ein neues Gebäude für den Elementar-
und Religionsunterricht bauen, das zugleich den Zugang zu der dahinter
gelegenen Synagoge auf dem gleichen Grundstück bildete. Ab 1913 wurde
die Schule nur noch für den Religionsunterricht genutzt. Mit zwei
hauptamtlichen Lehrkräften für bis zu 70 SchülerInnen war
sie im 19. Jahrhundert zeitweilig die größte jüdische
Schule in ganz Niederhessen.
Hinter dem alten
Schulgebäude war 1738/ 39 die Synagoge errichtet worden. Als Vierstützenbau
(typisch für die Bauweise der portugiesischen Juden) galt das an
sich schlichte Gotteshaus als eine architektonische Besonderheit.
Bei den Novemberpogromen
1938 wurde die Synagoge geschändet, die Fenster eingeschlagen, Inneneinrichtung
und Kultgegenstände zertrümmert und aus dem Haus geschleppt.
Die unmittelbare Nähe zu den Nachbargebäuden verhinderte, dass
die Synagoge niedergebrannt wurde.
Genau 200 Jahre
war die Synagoge das Zentrum der jüdischen Gemeinde von Rotenburg,
als sie 1939 zusammen mit dem Schulgebäude an einen privaten Käufer
abgetreten wurde, der sie als Scheune nutzte. Das baufällig gewordene
Gotteshaus wurde 1947 abgerissen. Einige sakrale Objekte sind erhalten
geblieben.

Das Foto (oben)
zeigt die ehem. Rotenburger Synagoge nach Kriegsende. In einem Bericht
von Pfarrer Hamann über die Geschehnisse im November 1938 (vollständig
nachzulesen bei Station 12 unseres Rundgangs) heißt es:
„Am furchtbarsten jedoch die Zertrümmerung der Synagoge
in der Brotgasse, bei der unter Leitung bzw. stillschweigender Duldung
der Lehrer Schulkinder durch Steinwürfe und tätliche Handlungen
das Zerstörungswerk verrichteten. (!)“
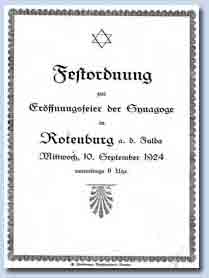
Die ortsansässigen Juden unterschieden sich in ihren Ansichten und Meinungen kaum von ihren Mitbürgern. So bescheinigt das Rotenburger Tageblatt, dass in den Reden jüdischer Mitbürger anlässlich der Einweihung der renovierten Synagoge 1924 neben „religiöser, alttestamentlicher Grundstimmung“ auch ein „tiefes Heimatgefühl“ und „Liebe zum Vaterland“ zum Ausdruck gebracht wurden. Anwesend waren Vertreter des öffentlichen Lebens vom Landrat, dem Schulrat, dem Bürgermeister bis hin zur evangelischen Pfarrerschaft. Alle Festredner betonten das gute Miteinander der verschiedenen Konfessionen in Rotenburg. Die volle Gleichstellung und Integration der Juden schien erreicht. Die jüdische Bevölkerung konnte sich als geachteter Bestandteil der Rotenburger Bürgerschaft betrachten.
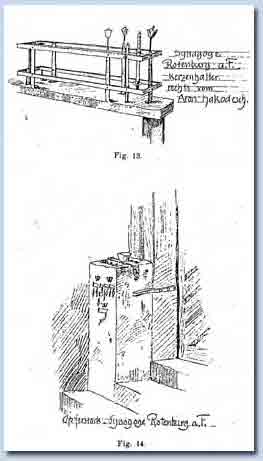
Zeichnungen von
Kerzenhalter und Opferstock aus der ehemaligen Rotenburger Synagoge.

Das einzige, verfügbare
Foto der Synagoge von 1939.
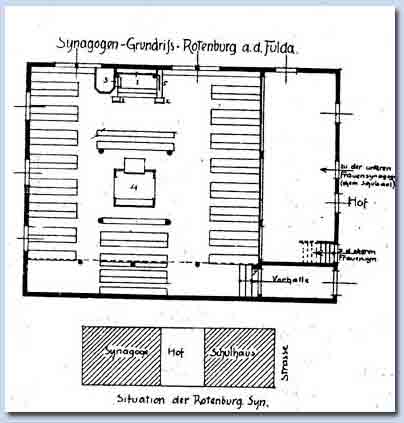

Das hier abgebildete Modell der Rotenburger Synagoge (im Maßstab 1: 10) vereinigt Elemente aus verschiedenen „postmodernen“ Rekonstruktionsvorschlägen, die von Schülerinnen und Schülern der Jakob-Grimm-Schule gemacht wurden. Das Modell entstand im Schuljahr 1996/97 im Grundkurs Architektur, den unsere verstorbene Kunsterzieherin Miriam Schaub leitete. Das Modell, gebaut von den Zwillingsschwestern Bierschenk aus Bebra-Breitenbach, vereinigt Elemente aus verschiedenen „post-modernen“ Rekonstruktionsvorschlägen der Kursteilnehmer. Die Umsetzung der Vorschläge in ein maßstabgerechtes Modell im Frühjahr 1998 brachte die 1996/97 gebildete ARBEITSGRUPPE SPURENSUCHE auf den Gedanken einer Dauerausstellung zur Tradition jüdischen Lebens in der Region. Mit der Einrichtung der Geschichtswerkstatt auf dem Dachboden der Jakob-Grimm-Schule (siehe Nr. 22 unseres Rundgangs) konnte dieses Vorhaben im Jahr 2002 realisiert werden.
Zu 100 Talern
Strafe wird die Rotenburger Judenschaft am 20. August 1739 von
der landgräflichen Administration in Kassel wegen des nicht
genehmigten Baus der Synagoge in der Brotgasse verurteilt: „weil
sie mit Vorbeygehung (=Umgehung) des Summi Episcopi (=des
Obersten Bischofs, d. h. des Landesherrn) eine besondere Schuhle oder
Synagoge zu erbauen sich unterstanden“.
Vorher ist in der Urkunde festgehalten, dass die Aufnahme der Juden grundsätzlich
die „Gewissensfreyheit und Haltung ihres Gottesdienstes in sich
begreift, alleine hierzu braucht es keiner Concession, sondern die Juden
halten, wie im ganzen Land bekannt, Schule (=Gottesdienst) in
ihren Häusern“. Sofern jedoch spezielle Gebäude für
ihren Gottesdienst in Anspruch genommen werden sollen, sei dies nur mit
der entsprechenden Genehmigung des Kasseler Landgrafen möglich. Die
Rotenburger Kanzlei erhält einen Verweis. Ihr wird vorgehalten, dass
sie dies habe wissen müssen („solches ohne Zweifel besser
verstanden oder wenigstens verstehen sollen“).
Die Thora-Rolle aus der Rotenburger Synagoge wurde während der antijüdischen Ausschreitungen im November 1938 schwer beschädigt. Sie befindet sich mit anderen sakralen Gegenständen im Magazin des Kreisheimatmuseums. Weil sie entweiht wurde, verzichtete später der Landesverband der Jüdischen Gemeinden Hessens auf deren Übergabe.
![]()

Einige Häuser
weiter auf der gegenüberliegenden Straßenseite (in Richtung
Steinweg) stoßen wir auf das Haus Brotgasse 6, in dem bis 1939 die
Schlosserfamilie Gans wohnte. Coppel Gans war 1882 einer der neun Gründer
der Freiwilligen Feuerwehr. Zehn der insges. 58 Mitglieder der Freiwilligen
Feuerwehr im Gründungsjahr 1882 waren Juden. Willy Gans, der Sohn
von Coppel Gans, war bis zur NS-Machtergreifung Gerätewart in der
Freiwilligen Feuerwehr und avancierte zum Adjutanten von Feuerwehrhauptmann
Karl-Adolf Schnell.
Das Haus mit den dahinter liegenden Gebäudeteilen hatte über
die Jahrhunderte hin jüdische Besitzer. Im Hinterhaus befand sich
bis zum Bau der Gemeindesynagoge 1738 eine von David Cappel eingerichtete
Privatsynagoge, die auch den übrigen Rotenburger Juden als Gotteshaus
diente. Die persönliche Verfügungsgewalt des Hauseigentümers
über die Nutzung des Gebäudes als Synagoge führte zu Unzufriedenheit
und Streit. Um diesem Zustand abzuhelfen, ließ die jüdische
Gemeinde Rotenburgs eine Synagoge auf dem Grundstück hinter dem Haus
Brotgasse 19 (= jüdische Schule) bauen, das man passieren musste,
um zur Synagoge zu gelangen.