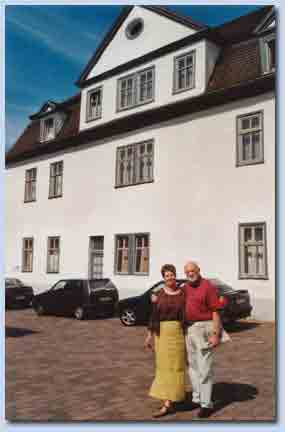
Bis 1934 lebte
hier die Familie Katzenstein. Auf dem Foto sehen wir die Tochter von Ester
Katzenstein, Prof. Barbara Einhorn (frisch verheiratet mit Dr. Paul Östreicher),
beim Besuch in Rotenburg im Juni 2002 vor dem Haus ihrer Vorfahren.

Die Mitte des 19. Jahrhunderts aus Heinebach zugezogenen Katzensteins handelten mit Altwaren. Siegfried Katzenstein, der Sohn des Firmengründers Salomon Katzenstein, wurde 1919 in die Stadtverordnetenversammlung gewählt, 1924 in den Magistrat. Bei den ersten NS-Massenausschreitungen am 1. April 1933 wurde Siegfied K. schwer misshandelt. Im Rückblick seiner Tochter Ruth: ”Sie haben den Vater rausgeholt, auf den Misthaufen geworfen und haben ihn halbtot geschlagen.”
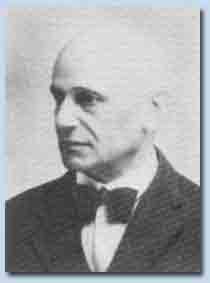
Weitere
Informationen zu Siegfried Katzenstein

Weitere
Informationen zu Ruth Gützlaff-Katzenstein
Ruth entging 1942
der Deportation in ein Vernichtungslager durch eine eidesstattliche Erklärung
ihrer (nichtjüdischen) Mutter, dass Siegfried K. nicht der leibliche
Vater seiner Tochter sei. Durch richterlichen Entscheid (”weist
keine kennzeichnend jüdischen Rassemerkmale auf”) wurde
Ruth zur ”Arierin” erhoben. In einem "Komplott"
mit ihrer Mutter und deren Verwandten in Erfurt verschaffte sich Ruth
im Juli 1942 den Nachweis "rein arischer" Abstammung und rettete
sich so vor dem Abtransport in eines der Vernichtungslager: Ihre "arische"
Mutter Wilhelmine gab am 10. Juli 1942 die eidesstattliche Erklärung
ab, nicht ihr Ehemann Siegfried Katzenstein, sondern der inzwischen verstorbene
Vetter Max Grimmer aus Erfurt sei der leibliche Vater ihrer Tochter Ruth.
Daraufhin erklärte das Landgericht Berlin am 17. August 1942 ihre
Tochter Ruth zur „reinrassigen“ Deutschen, und zwar auf der
Grundlage des Gutachtens der „Poliklinik für Erb- und Rassenpflege
in Berlin-Charlottenburg":
1. Der Prüfling weist keine kennzeichnend jüdischen Rassemerkmale
auf.
2. Nach dem Erscheinungsbild des Prüflings ist nicht anzunehmen,
daß er von seinem gesetzlichen Vater abstammt.
3. Es ist vielmehr anzunehmen, daß der Prüfling von einem Mann
deutschen oder artverwandten Blutes (in vorliegendem Fall ist an Grimmer
zu denken) erzeugt worden ist.
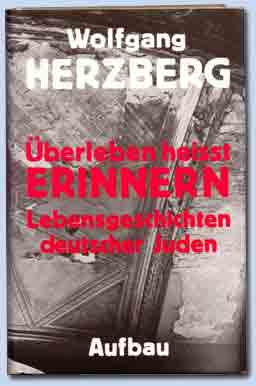
Das Schicksal von
Ruth Gütslaff-Katzenstein ist in dem Buch von Wolfgang Herzberg
ausführlich dargestellt.
Die Familie Katzenstein
war in den 1860er Jahren aus dem benachbarten Heinebach nach Rotenburg
gekommen. Über Siegfried Katzensteins Bruder Moritz lesen wir in
dem 1932 erschienenen „Biographischen Lexikon hervorragender Ärzte":
Moritz Katzenstein, geb. 14.8.1872 in Rotenburg a. d. F., gest. 25.3.1932
in Berlin, Studium in Freiburg u. München (dort 1895 Promotion).
Weitere Ausbildung unter Professor James Israel am jüdischen Krankenhaus
in Berlin. Er habilitierte sich 1911 in Berlin für Chirurgie, 1913
Ernennung zum außerordentlichen, 1921 zum ordentlichen Professor
für Chirurgie. Gleichzeitig war er Direktor am Krankenhaus Friedrichshain.
Wissenschaftlich beschäftigte er sich hauptsächlich mit experimenteller
Chirurgie. Seine Arbeiten betreffen den arteriellen Kollateralkreislauf,
die Funktionsprüfung des Herzens (Katzenstein'sche Methode), die
Entstehung des Magengeschwürs und der Pseudarthrose, die Kryptorchismusoperation,
die Elastizität und Neubildung der Gelenkbänder sowie die Gewebsimmunität.
Für den Ergänzungsband des "Handbuchs der experimentellen
Therapie (München 1931) schrieb er das Kapitel „Die Verwertung
von lokalen Immunitätsvorgängen in der Chirurgie".
Ganz ungewöhnlich an seiner Karriere als Mediziner ist der medizinische
Bereich, in dem er seine Meriten erwarb. Die Chirurgie als klassischer
Bereich der Medizin war seinerzeit nämlich so gut wie ausnahmslos
in Händen arischer „Seilschaften". Jüdischen Medizinern
standen in der Regel nur in den neueren Spezialfächern wie Mikrobiologie,
Dermatologie und Psychiatrie die Karrierewege offen, weil diese im Unterschied
etwa zur Chirurgie nicht so stark der Kontrolle durch das medizinische
Establishment unterlagen.
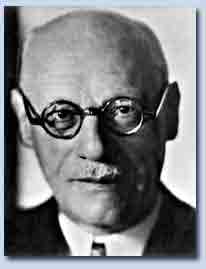
Weitere
Informationen zu Prof. Moritz Katzenstein
![]()
In dem Haus
Im Zwickel 13 hatte in den 1870 Jahren der Obergerichtsanwalt Moses Berlein
seine Kanzlei.
Der aus Marburg stammende Moses Berlein gehörte zu den Rotenburger
Honoratioren, die 1872 für würdig befunden wurden, mit ihrem
Namen für die „Kaiser-Wilhelms-Stiftung“ zu werben. 1844
war Moses Berlein in Rotenburg als einer der ersten 40 jüdischen
Anwälte in Deutschland zugelassen worden. Er trug den Titel eines
„Obergerichtsanwalts“. 1848 hatte er sich heftigsten Anfeindungen
seiner Rotenburger Berufskollegen ausgesetzt gesehen. Sein Sohn Julius
machte der Stadt Rotenburg 1904 von London aus eine großzügige
Geldspende von 400 Goldmark zur Einrichtung eines Stadtarchivs. Ein Teil
des Geldes wurde 1922 zur Anschaffung von repräsentativem Möbel
für das Amtszimmer des Rotenburger Bürgermeisters verwendet.

Moses Berlein und
seine Frau Adelheid sind auf dem jüdischen
Friedhof in Rotenburg begraben. Obelisken aus Granit schmücken
ihre Grabstätten.