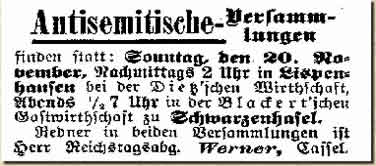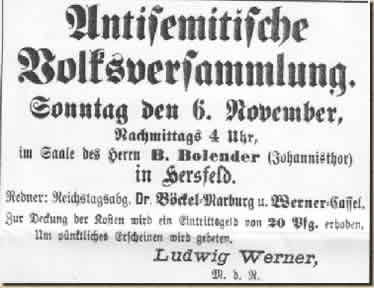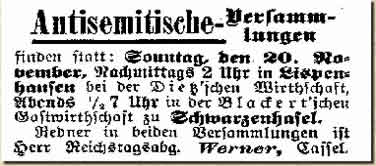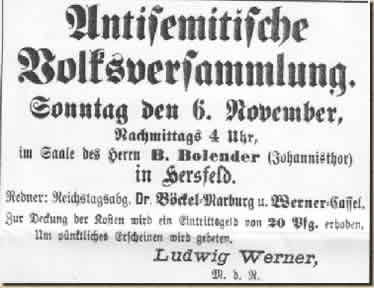Die
allgemeinen Voraussetzungen für den Wahlerfolg der Antisemiten
Werner durchzog systematisch den Wahlkreis und hielt in den meisten Gemeinden
Versammlungen ab. Seine Agitation vermochte die latente Spannung zwischen Bauern
und kleinen Handwerkern einerseits und den jüdischen Händlern und
Geldverleihern andererseits zu aktualisieren. Die allgemeine Abneigung gegen
die Juden nutzten die Antisemiten aus, indem sie alle Interessen dieser Abneigung
unterordneten; die jüdische Minderheit (1895 = 1,6% der Bevölkerung
des Landkreises Hersfeld, % des LK Rotenburg, % des LK Hünfeld) aber konnte
bei ihrer geringen zahlenmäßigen Stärke keinen Einfluß
auf den Ausgang der Wahlen ausüben. Begünstigt wurde Werners Agitation
durch die allgemeine landwirtschaftliche Krise: Verschuldung, ungünstige
Betriebsstruktur, schlechte Ernteaussichten, niedrige Preise. "Ganz unverkennbar,
daß in der Bevölkerung eine allgemeine Mißstimmung herrscht",
meldete der Hersfelder Landrat in seinem Vierteljahresbericht an den Regierungspräsidenten
vom 30. 8. 1893. Verantwortlich dafür machte der Landrat "die allgemeinen
Zustände, wie sie sich unter dem Einfluß der sogenannten liberalen
Ära und den Folgen der Gesetzgebung jener Zeit entwickelt haben".
Vor allem jene Bevölkerungsteile, die sich im neuen Reich nicht mehr bzw.
noch nicht zu Hause fühlten, ließen sich durch die antisemitische
Agitation ansprechen. "Es waren vorkapitalistische Schichten, die ihre
gesellschaftliche Stellung und kulturelle Tradition bedroht sahen.", wie
W. Massing (1959, S. 8) formuliert. Dazu zählten in erster Linie die Handwerker,
kleine Unternehmer, mittlere Beamte, Angestellte und vor allem die kleinen und
mittleren Bauern, also der ökonomisch schlechter gestellte Teil des Mittelstandes.
“Das ausweglose Kleinbürgertum flüchtet vor der sachlichen Interpretation
der wirtschaftlichen Entwicklung, die ihm ungünstig ist, in eine Scheininterpretation,
die ihm Erfolg verspricht, indem sie ihm erlaubt, statt des abstrakten Kapitals
den konkreten Juden anzugreifen", wie es Eva Reichmann in ihrem Buch “Flucht
in den Haß (1956, S. 69) formuliert. In den Juden glaubte man aber nicht
nur die Ursache für die Bedrohung seiner sozialen Sicherheit und seines
sozialen Status, sondern auch für die Bedrohung von Staat und Gesellschaft
gefunden zu haben. Dieses Bild "des Juden" hatte mit seiner tatsächlichen
Rolle in der Gesellschaft kaum etwas gemein, sondern kam einem Mythos gleich.